Masada
 Die
ehemalige jüdische Festung Masada (hebräisch מצדה Mezadá
„Festung“) befindet sich in Israel am Südwestende des Toten
Meeres; sie ist heute Teil eines nach ihr benannten israelischen
Nationalparks. Das archäologische Ausgrabungsgelände Masada
wurde 2001 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.
Die
ehemalige jüdische Festung Masada (hebräisch מצדה Mezadá
„Festung“) befindet sich in Israel am Südwestende des Toten
Meeres; sie ist heute Teil eines nach ihr benannten israelischen
Nationalparks. Das archäologische Ausgrabungsgelände Masada
wurde 2001 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.
Lage
Masada ist ein isolierter Tafelberg, Teil des Judäischen Gebirges entlang des Westrandes des Jordangrabens, zwischen Totem Meer und Judäischer Wüste gelegen. Durch ein Wadi im Westen wird es von dem Rest des Gebirgsstocks isoliert. Während der Höhenunterschied zum östlich gelegenen Toten Meer über 400 Meter beträgt, ist der Abhang Richtung Westen 100 Meter hoch. Sein Gipfel wird durch eine Hochfläche gebildet. Felsige Steilabhänge schützen sie nach allen Seiten. Ursprünglich war das Plateau nur über drei schmale Saumpfade zugänglich.
Bau
Die Festung wurde im Wesentlichen im Auftrag von König Herodes I. (dem Großen) (73–4 v. Chr.) etwa zwischen 40 v. Chr. und 30 v. Chr. an der Stelle einer einige Jahrzehnte älteren und kleineren Festung in drei Phasen erbaut. Zu ihrer Zeit galt sie als uneinnehmbar. Nach dem Tode von Herodes war hier eine römische Garnison stationiert.
Struktur
 Allein
durch die Lage und die gute Einsehbarkeit der Zugangswege war
das 300 mal 600 Meter große und weitgehend ebene Gipfelplateau
in Form einer Raute gut zu verteidigen. Zur Festung wurde der
Berg durch die Bauten des Herodes – er ließ um das Plateau eine
Kasemattenmauer mit fast 40 Türmen anlegen. Innerhalb der
Festungsmauer ließ er eine große Zahl weiterer Gebäude bauen,
unter anderem Lagerhäuser, Pferdeställe, eine Kommandantur,
Unterkünfte, Badehäuser, Schwimmbecken und Paläste, darunter den
über mehrere Stufen in den Berghang hinein geschlagenen
Nordpalast. Er bietet eine großartige Aussicht über die
Judäische Wüste und mit seiner Nordausrichtung die klimatisch
günstigste Position am Berg im Sommer. Der Palast war aus
Kalkstein erbaut und mit Wandmalereien im pompejanischen Stil
und zahlreichen Mosaiken ausgestattet. Auf seiner Ostseite lag
das königliche Badehaus.
Allein
durch die Lage und die gute Einsehbarkeit der Zugangswege war
das 300 mal 600 Meter große und weitgehend ebene Gipfelplateau
in Form einer Raute gut zu verteidigen. Zur Festung wurde der
Berg durch die Bauten des Herodes – er ließ um das Plateau eine
Kasemattenmauer mit fast 40 Türmen anlegen. Innerhalb der
Festungsmauer ließ er eine große Zahl weiterer Gebäude bauen,
unter anderem Lagerhäuser, Pferdeställe, eine Kommandantur,
Unterkünfte, Badehäuser, Schwimmbecken und Paläste, darunter den
über mehrere Stufen in den Berghang hinein geschlagenen
Nordpalast. Er bietet eine großartige Aussicht über die
Judäische Wüste und mit seiner Nordausrichtung die klimatisch
günstigste Position am Berg im Sommer. Der Palast war aus
Kalkstein erbaut und mit Wandmalereien im pompejanischen Stil
und zahlreichen Mosaiken ausgestattet. Auf seiner Ostseite lag
das königliche Badehaus.
Um die Wüstenfestung verteidigen zu können, wurden große Nahrungsvorräte angelegt und am nordwestlichen Hang zwölf Zisternen gegraben, die mehrere zehntausend Kubikmeter Regenwasser speichern konnten. Das Wasser wurde durch zwei Aquädukte herangebracht. Es diente als Trinkwasser, wurde aber auch für die Schwimmbecken und Badehäuser genutzt.
Geschichte
Rolle im
Jüdischen Krieg

Einige Jahrzehnte nach Herodes'
Tod kam es 66 n. Chr. zum Jüdischen Krieg gegen die römische
Besatzung. Eine Gruppe von Sikariern überraschte die römische
Garnison und nahm Masada ein. Rebellen aus verschiedenen
politischen Gruppierungen siedelten sich auf dem Gelände der
Festung an, besonders nach der Zerstörung des Zweiten Tempels in
Jerusalem durch Titus 70 n. Chr. Sie errichteten eine Reihe von
Gebäuden, darunter Wohnhäuser, eine Synagoge, eine Bäckerei,
eine Mikwe, Taubenhäuser und Wohnhöhlen.
Im Jahr 73/74 n. Chr. wurde Masada von der 10. Legion sowie
knapp 4000 Auxiliarsoldaten unter dem Befehlshaber Flavius Silva
belagert.[ Der jüdisch-römische Historiker Flavius Josephus
überliefert die Belagerungsgeschichte Masadas in seiner
Geschichte des jüdischen Krieges (Bellum Iudaicum 7, 252-406).
Der Feldherr ließ den Berg mit einer über vier Kilometer langen
Mauer umgeben (circumvallatio), die durch acht Kastelle
unterschiedlicher Größe gesichert wurde. Die Reste der Kastelle
und der Mauer sind bis heute sichtbar.
Anschließend schütteten
die Römer an der niedrigeren Westseite der Festung eine noch
immer gut erhaltene Belagerungsrampe auf, die schließlich bis an
die Mauern der Festung reichte. Die Belagerungsrampe setzt teils
auf einer natürlichen geologischen Erhebung auf, was den Bau
enorm verkürzt hat. Über diese Rampe führten sie Rammböcke und
andere Belagerungsmaschinen an die Festung heran, um die Mauer
zum Einsturz zu bringen. Die Belagerung dauerte nur einige
Monate. Eine häufig behauptete längere Belagerungszeit ist nicht
nachgewiesen.
Flavius Josephus berichtet, dass die Belagerten unter Führung
von Eleazar ben-Ya'ir, als die Lage aussichtslos wurde,
beschlossen, lieber als freie Menschen zu sterben, als den
Römern in die Hände zu fallen: „Ein ruhmvoller Tod ist besser
als ein Leben im Elend.“ Per Los bestimmten sie einige Männer,
die wechselseitig den Rest der Gruppe und anschließend sich
selbst töten sollten. Als die römischen Soldaten die Festung
stürmten, erwartete sie nur Totenstille: 960 Männer und Frauen
hatten sich samt ihren Kindern getötet. Nur zwei Frauen und fünf
Kinder hatten sich verborgen gehalten und konnten berichten, was
geschehen war. Die Römer „bewunderten den Mut ihrer
Entscheidung“. Die Tat macht Masada bis heute zum Symbol des
jüdischen Freiheitswillens.
Mittelalter
Nach ihrem Fall blieb Masada verlassen. Im 5. und 6. Jahrhundert wurde der Berg durch christliche Mönche besiedelt. Sie erbauten eine Kirche, die zu den frühesten Kirchen im südlichen Judäa gehört; Reste sind bis heute erhalten geblieben.
Neuzeit
Wiederentdeckung
Die Festung geriet schließlich in Vergessenheit, bis sie im Jahre 1838 durch die beiden amerikanischen Gelehrten Edward Robinson und E. Smith wiederentdeckt wurde. Sie sahen sie von En Gedi aus und identifizierten sie richtig. Obwohl Masada lange vergessen war und außerdem die historische Zuverlässigkeit der Berichte von Flavius Josephus umstritten ist, entfaltete die Überlieferung große Wirkung. Der Mythos von Masada wurde ein wichtiger Bestandteil der zionistischen Idee. Während des Zweiten Weltkriegs sollte der Berg Karmel als „zweites Masada“ dienen. Seit 1948 wurde die Festung von Mitgliedern der zionistischen Jugendbewegung und der Streitkräfte als nationales Symbol aufgesucht.
Ausgrabungen
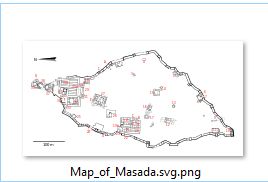
1955–1956 führten die Israel Exploration Society, die Hebräische Universität Jerusalem und die Abteilung für Altertümer des Erziehungsministeriums eine erste Geländeaufnahme unter Leitung von Nahman Avigad durch.
1963–1965 grub Yigael Yadin von der Hebräischen Universität
Jerusalem mit Unterstützung der anderen genannten Institutionen
große Teile der Festung aus. Tausende Freiwillige aus vielen
verschiedenen Ländern nahmen an den Ausgrabungen teil. Die Funde
werden erst jetzt allmählich publiziert. Interessant ist
beispielsweise ein Hortfund mit Münzen des Jüdischen Krieges,
darunter sehr seltene Exemplare aus dem fünften Kriegsjahr.
Durch die große Trockenheit haben sich Funde aus organischem
Material ausgezeichnet erhalten. Bei den Ausgrabungen auf Masada
wurden beispielsweise etwa 2000 Jahre alte Dattelkerne gefunden.
Forscher brachten 2005 einen der Keime zum Wachsen. Ab 1966
führte die Abteilung für Landschaftsgestaltung und die Erhaltung
historischer Bauwerke (heute Nationalpark-Behörde, NPA)
Erhaltungsmaßnahmen und Rekonstruktionen durch. Die
Rekonstruktionen wurden weitgehend mit Zement ausgeführt, was
bald zu Schäden an der historischen Bausubstanz führte. Sie
wurden inzwischen weitgehend durch geeignetere Materialien
ersetzt. Die Erhaltung der Ruinen wird heute durch das
Ministerium für Tourismus finanziert und obliegt einem Team der
Israel Antiquities Authority.
1989 führte Ehud Netzer von der Hebräischen Universität
Jerusalem weitere Grabungen durch, gefolgt durch Arbeiten von E.
Foester 1995 an der römischen Rampe und im römischen Lager „F“.
Politische Bedeutung
Die Vorgänge um die Festung
Masada haben einen erheblichen Einfluss auf das
Selbstverständnis der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte.
Die jährlichen Abschlussmanöver der militärischen
Grundausbildung endeten zwischen 1965 und 1991 nach zwei Tagen
Dauer auf der Festung. Im Schwur der Soldaten wurde die Festung
zu einem Symbol des jüdischen Selbstbehauptungswillens: „Masada
darf nie wieder fallen“. Inzwischen findet das militärische
Zeremoniell nicht mehr statt, da der Vergleich mit den
fanatischen Sikariern gescheut wird, ebenso wie die Assoziation
mit dem kollektiven Selbstmord. Die Synagoge von Masada wird
heute gerne für Bar Mitzwas genutzt.
Masada ist eine wichtige Attraktion für Touristen, die das Tote
Meer, die Wüste Negev und die nahe gelegene Oase En Gedi
besuchen.
Touristische Erschließung
Seit den frühen 1960er Jahren
wurde geplant, in Masada einen Nationalpark anzulegen. Die
Nationalparkbehörde wurde 1963 gegründet, 1966 wurde Masada
durch das Innenministerium zum Nationalpark erklärt. Er umfasst
230 ha und schließt die Festung und die römischen
Belagerungswerke ein. 1967 wurde die Fläche auf 340 ha
erweitert, sie umfasste nun auch Teile der Straße nach Arad. Der
Zugang zur Festung erfolgte durch den Schlangenpfad am
Ostabhang.
Seit 1971 führt eine 900 m lange Luftseilbahn, die Masadabahn,
von −257 m auf das Gipfelplateau in 33 m NN. Sie ist die
tiefstgelegene Seilbahn der Welt. Die Einrichtung der Seilbahn
war sehr umstritten, da sie das Aussehen der Fundstelle stark
veränderte. Sie hat zudem die Besucherzahlen extrem verstärkt.
Im Jahr 2000 hatte die Festung 700.000 Besucher. Da es zu langen
Wartezeiten kam, wurde zwischen 1995 und 2000 eine neue Seilbahn
errichtet, die über umgerechnet 40 Millionen € kostete. Sie nahm
1999 den Betrieb auf. Eine Brücke verbindet die Endstation mit
dem Schlangenpfad-Tor. An der Talstation der Bahn wurde 2000 ein
neuer Eingang mit einem kleinen Museum geschaffen. Seitdem haben
auch behinderte Besucher Zugang.
2001 wurde Masada in die Liste
des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit der UNESCO
aufgenommen.
Im September 2011 eröffnete McDonald’s eine Filiale im
Besucherzentrum, was nicht ohne Proteste blieb.
Vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Masada




